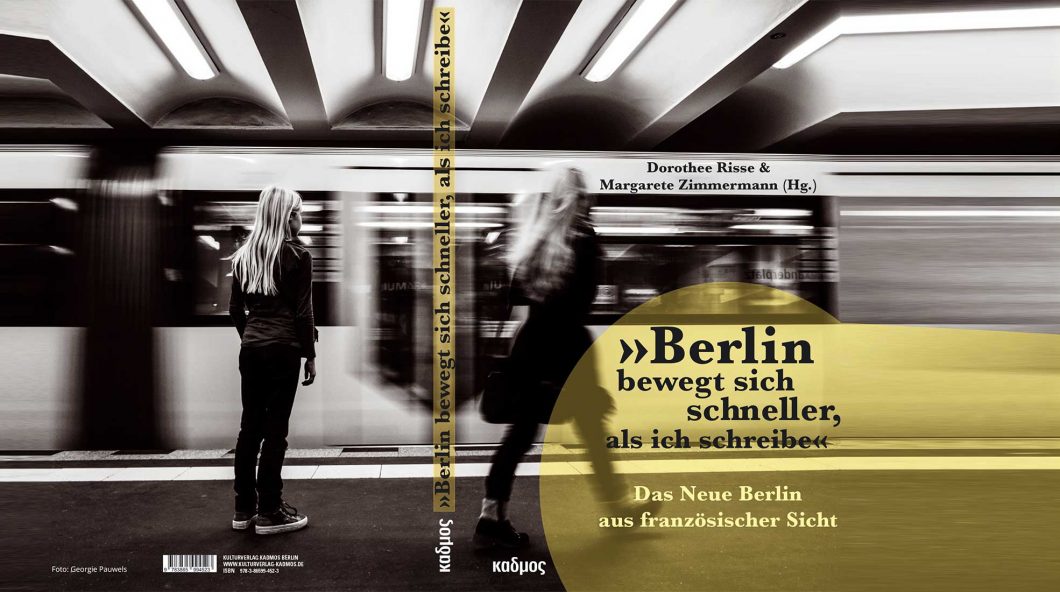Zwischen den Welten – Begegnungen mit der Schriftstellerin Cécile Wajsbrot und der Übersetzerin Karin Uttendörfer
Ein Dokumentarfilm, der vom Leben in Tschernobyl vor der Reaktorkatastrophe und der Renaturierung der menschenleeren, „verbotenen Zone“ handelte, sprach die Schriftstellerin Cécile Wajsbrot direkt an. Beim Anblick der (immer noch kontaminierten) Kornfelder, Bäche und Wiesen rezitierte sie innerlich Sätze aus Virginia Woolfes To the Lighthouse. Woolfes Roman erzählt vom Zerfall eines Hauses, das unweigerlich von der Natur überwuchert wird. Für Menschen ist darin kein Platz mehr. Langsam nahm der Gedanke Form an, einen Roman zu schreiben, in dem sich Reflexionen über von der Natur verwandelte urbane Räume mit der subtilen Arbeit des Übersetzens eben jenes ästhetisch hoch anspruchsvollen Romans von Virginia Woolfe verweben.
Im Zentrum von Cécile Wajsbrots neuer Prosa Nevermore steht eine Übersetzerin. Sie ist die Ich-Erzählerin. Zuhause ist sie in Paris. Um den englischen Text ins Französische zu übertragen, geht sie aber nach Dresden. Sie glaubt, dass die „einst vom Krieg verwüstete Stadt“ der richtige Ort ist, um über „die Verwüstungen der Zeit“ nachzudenken. Sie möchte das Gefühl von Fremdheit auskosten, ins Zwiegespräch kommen mit ihren inneren Geistern und den plötzlich aufscheinenden Schatten vertrauter Verstorbener erhaschen.
Nevermore spielt subtil auf Edgar Allan Poes Gedicht The Raven an. Nein, die Toten lassen sich nicht zum Leben erwecken. Und ja, „auch der Tod muss seine Arbeit verrichten dürfen und sich vom Leben entfernen“. Es ist ganz wunderbar, wie Cécile Wajsbrot für jedes ihrer Bücher einen neuen Ton und eine spezielle Struktur findet. Seit Jahren wird immer offensichtlicher, welche Rolle die Musik für ihr Schreiben spielt – und wie gut es ihr gelingt, Texte zu komponieren, in denen Stimmen einander überlagern. Sie sind wie Partituren verfasst.
Die in Frankreich lebende Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber hat – nun schon zum zweiten Mal – einen Roman von Cécile Wajsbrot ins Französische übersetzt. Kongenial.
Die literarische Übersetzerin Karin Uttendörfer „fremdelt“ mit dem Begriff der Kongenialität. Im September 2021 hat sie, zusammen mit der franko-japanischen Lyriker und Autorin Ryoko Sekiguchi, in Tübingen den neu gestifteten Prix Premiere erhalten: für Nagori. Die Sehnsucht nach der von uns gegangenen Jahreszeit. Der Preis geht an Autor:innen, von denen zum ersten Mal ein Buch ins Deutsche übersetzt worden ist, und zugleich werden auch die Übersetzer:innen geehrt.
In unserer Folge schildert Karin Uttendörfer das hochkomplexe Konzept, für das das japanische Wort Nagori steht und sie beschreibt, wie ihre sinnliche Wahrnehmung sich während des Übersetzungsprozesses verfeinerte und sie noch achtsamer zu leben begann. „Nagori steht vor allem für die spürbare Präsenz einer Sache oder Person, insbesondere einer Jahreszeit, die schon vergangen oder gerade am Verschwinden ist. Und diesem Verschwinden wohnt immer schon die Sehnsucht nach Wiederkehr und damit die Hoffnung auf einen Neubeginn inne. Weiter gefasst bezeichnet es das, was zurückbleibt.“ Ein Kind hat seine Eltern verloren, aber sie werden von all jenen erinnert, die sie zu Lebzeiten gekannt haben. Am Ende einer Saison bleiben stets ein paar Früchte oder vereinzelte Blüten an den Ästen der Bäume hängen. Nagori „evoziert immer auch einen Abschiedsschmerz“.
Kleine Auswahl aus dem Oeuvre von Cécile Wajsbrot:
Nevermore. Roman. Übersetzt von Anne Weber. Wallstein Verlag, Göttingen, Juli 2021
Zerstörung. Übersetzt von Anne Weber. Wallstein Verlag, Göttingen, 2020
Totale éclipse, Übersetzt von Nathalie Mälzer. Matthes & Seitz, Berlin 2016
Aus der Nacht, Übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. Liebeskind, München 2008
Mann und Frau den Mond betrachtend. Übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. Liebeskind, München 2002
Ryoko Sekiguchi:Nagori. Die Sehnsucht nach der von uns gegangenen Jahreszeit. Übersetzt von Karin Uttendörfer. Matthes & Seitz, Berlin, 2020
Hinweis: Claudia Andujar, La Lutte Yanomami/ Der Überlebenskampf der Yanomami, ab 23.10.21- 13.02.22 im Fotomuseum Winterthur
Der Prix Premiere wird vom Deutsch-Französischen Kulturinstitut Tübingen, dem Bureau du livre des Institut français Deutschland und dem Verein der Freunde des Instituts Tübingen gestiftet. Er ist mit 1000 € pro Person dotiert.
Aktuelle Shortlist für den Prix Premiere 2022:
Antoine Wauters: Denk an die Steine unter deinen Füßen. Roman. Übersetzt von Paul Sourzac. Secession Verlag, September 2021
Julia Kerninon: Du wirst es niemals sagen. Übersetzt von Hanna van Laak. Karl Blessing Verlag, Mai 2021
Pascal Janovjak: Der Zoo in Rom. Übersetzt von Lydia Dimitrow. Lenos Verlag, April 2021